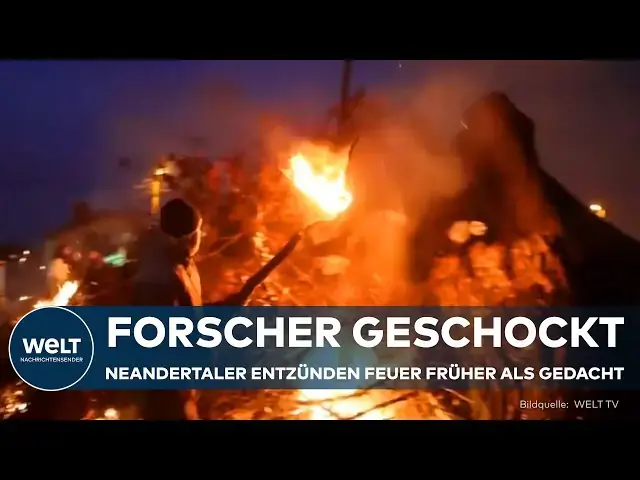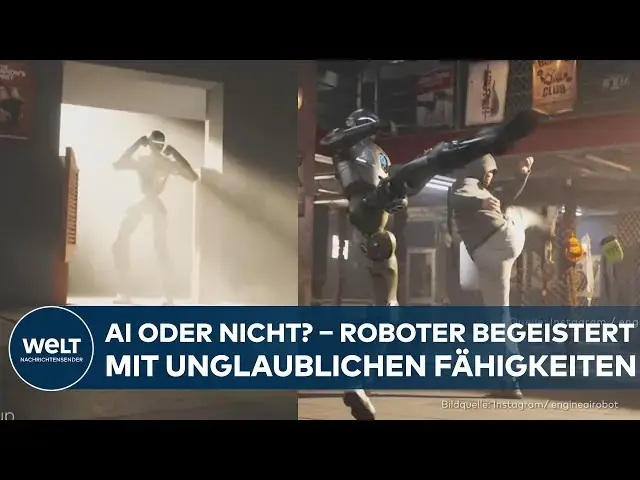Dieses Video wurde am 6. Juli 2025 von ntv Nachrichten auf YouTube veröffentlicht. Zum Original-Video auf YouTube.
Der Marmorkrebs, ein Klonwesen, fasziniert Forscher. Er dient als Modell in der Krebsforschung und könnte eine nachhaltige Proteinquelle werden. Ein Startup revolutioniert nun die Lebensmittelproduktion.
Millionen von weiblichen Marmorkrebsen vermehren sich ohne Männchen durch Eierlegen. Alle stammen von derselben Urmutter ab und klonen sich genetisch identisch. Diese Besonderheit macht den Marmorkrebs zu einem idealen Forschungsobjekt im Deutschen Krebszentrum Heidelberg. Tumorforscher Frank Lyko erklärt die Wahl: Die Selbstfortpflanzung und das Klonen ähneln dem Verhalten von Tumorzellen, was Parallelen für die Krebsforschung bietet.
In speziell simulierten Umgebungen wird untersucht, wie die Krebse auf unterschiedliche Wassertemperaturen reagieren. Veränderungen der Umweltbedingungen beeinflussen die Gene der Marmorkrebse, ähnlich wie bei Tumorzellen im menschlichen Körper. Ziel ist es, besser zu verstehen, wie sich Zellen zu Tumoren entwickeln und welche Umstände dies begünstigen. Diese Erkenntnisse sind entscheidend, da Tumorentwicklung im Patienten oft zu spät erkannt wird.
Der Marmorkrebs gilt als invasive Art, die einheimische Krebse verdrängt. Forscher Frank Lyko erkannte das Potenzial der Anpassungsfähigkeit des Krebses und entwickelte die Idee, ihn als Nahrungsprotein zu nutzen. Daraus entstand ein Startup, das sich der Produktion von nachhaltigen Lebensmitteln widmet.
„Wir müssen nicht darauf achten, dass Männchen und Weibchen in einem Becken sind. Wir müssen nicht darauf achten, dass die Verhältnisse passen, sondern dieser Krebs legt einfach in regelmäßigen Zyklen Eier und klont sich selbst.“
Das Startup zielt darauf ab, den Marmorkrebs als umweltfreundliche Proteinquelle zu etablieren. Andere Initiativen testen die Verwendung invasiver Krebse in Restaurants oder die Herstellung von Bier. Der Trend zu alternativen Proteinen ist bereits erkennbar. Das Krebsfleisch ist schmackhaft, proteinreich und fettarm. Zudem wird an der Verwertung des Panzers gearbeitet, um Biokunststoffe herzustellen.